|
| 
|
Doppelte Batterie 2
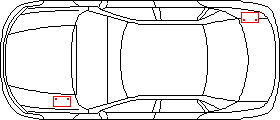
Diese Seite bezieht sich nicht auf die in Reihe geschalteten Batterien bei Nutzfahrzeugen. Das können Sie hier nachlesen. |
Die heute noch immer verwendeten Batterien gehören von den Grundlagen ihrer Konstruktion her mit zu den ältesten elektrischen Bauteilen in modernen Fahrzeugen. Gleichzeitig ist der Bedarf ständig gewachsen,
obwohl gerade beim stärksten Verbraucher, dem Starter, deutliche Einsparungen möglich wurden. Das bedeutet nicht mehr so sehr die einmalige Belastung der Batterie beim Start, sondern eine ständige wegen der
vielen anderen Verbraucher.
Batterien in Mittelklassewagen ermöglichen Nennströme bis zu 900 A. Für Zehnzylinder-Dieselmotoren werden Starterbatterien mit 85 Ah eingebaut. Ein-Liter-Autos kann es in Zukunft schon deshalb kaum geben,
weil bei vielen Fahrzeugen der Verbrauch zur Erzeugung von elektrischem Strom höher ist. So ist es gar nicht mehr verwunderlich, dass mit der Größe der Batterien auch der Wunsch wuchs, diese auf ein
handelsübliches Format zu teilen und dann auch mehr Sicherheit für eine garantierte Startleistung zu schaffen. Die ersten kommen in Oberklasse-Fahrzeugen mit dem größten Strombedarf vor.
Von den beiden Batterien ist eine für den Startvorgang und eine für das Bordnetz zuständig. Eine ausgeklügelte Bordelektronik sorgt für immer genügend Energie der Startbatterie. Diese schafft eine eher hohe
Leistungsdichte, Kapazität und Gewicht sind gering. Letzteres befähigt sie besonders zur Position vorn im Motorraum in der Nähe des Starters. Dadurch bleibt auch das in der Regel dicke Starterkabel kurz. Die
andere, eher schwerere Batterie wird zu einem gewissen Gewichtsausgleich hinten montiert. Deren Kapazität richtet sich nach den Bedürfnissen des übrigen Bordnetzes. Es kann während des Startvorgangs
getrennt werden, was Steuergeräte vor unzulässig geringen Spannungen schützt.
Innerhalb eines gewissen Toleranzbereiches darf die eine Batterie die andere unterstützen. Deshalb muss die Starterbatterie nicht auf den maximalen Kaltstartstrom des Motors und der startrelevanten Verbraucher
ausgelegt sein, weil sie beim Kaltstart Hilfe von der Bordnetzbatterie erhält, während beim Warmstart beide Batterien grundsätzlich getrennt werden. Dies alles wird gesteuert durch ein Management, das auch bei
Überlastung des Systems reagiert. Hier kann die Energielieferung für bestimmte Komfortsysteme verringert oder ganz abgeschaltet werden.
Zu dem System der Bordnetzüberwachung, das es übrigens auch schon in wesentlich preiswerteren Fahrzeugen ohne doppelte Batterie gibt, gehören Sensoren für die Batteriespannung und -temperatur, mind. ein
Steuergerät und anzusteuernde Umschaltrelais. Über CAN-Bus wird Kontakt u.a. zum Armaturenbrett-Steuergerät aufgenommen, um z.B. bei
Unterspannung
unnötige Heizverbraucher abzuschalten. Natürlich muss dann auch für Display-Ausgabe gesorgt werden. Die Steuerung erfasst sogar Crashereignisse von Airbag-Steuergeräten. In diesem Fall werden alle oder
bestimmte Teile der Spannungserzeugung abgeschaltet, bisweilen so energisch, dass erst ein Werkstattbesuch nötig ist, um die Schaltung wieder rückgängig zu machen. Aber wahrscheinlich ist dieser ohnehin
wegen des Crashereignisses notwendig.
Nicht nur bei doppelter Auslegung der Batterie, auch bei Verlagerung in den Kofferraum wird ein Problem sichtbar, das bei Lagerung im Motorraum eine geringere Rolle spielt. Batterien sind empfindlich gegen zu viel
Wärme oder auch Kälte. Im Motorraum wurden sie stets so platziert, dass ihre Arbeitstemperatur weder über- noch unterschritten wurde. Manche erhielten früher sogar einen eigenen Ventilator zur Kühlung. Dies
muss auch bei Auslagerung in den Laderaum berücksichtigt werden. Hinzu kommt - außer bei vollkommen wartungsfreien Batterien - die Möglichkeit, dass Gase ausströmen. Der Raum
für die Batterie muss dann eine ausreichende Entlüftung haben. 11/12
| Ladezustand | Gefrierpunkt
Elektrolyt |
| 100 % | -67°C |
| 75 % | -37°C |
| 50 % | -23°C |
| 25 % | -15°C |
| 0 % | -6,7°C |
|
|