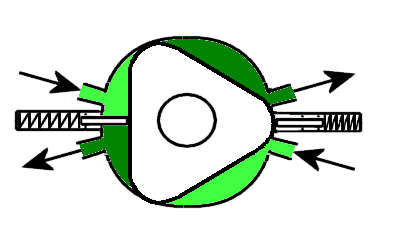
| Arbeitsweise der Kraftstoff-Förderpumpe |
Aufgabe
Schon Rudolf Diesel hatte die Idee dazu, wie Skizzen aus der Zeit der Entwicklung des ersten Dieselmotors beweisen. Allerdings waren Passungen bis
zu 1/10000 mm
zu dieser Zeit noch nicht möglich. Überhaupt gab es noch keine hydraulische Einspritzung. Darauf musste die Welt noch 30 Jahre bis zur ersten Einspritzpumpe und weitere 30 bis zu den ersten Motoren mit
Pumpedüse warten. Aber auch diese wurden über den Schiffsdiesel dann langsam in den Lkw-Bereich eingeführt und es dauerte noch einmal 40 Jahre, bis auch kleine Dieselmotoren mit dieser Technik ausgerüstet
werden konnten.
Die Vorgänger dieser Motoren waren Direkteinspritzer mit Verteiler-
Einspritzpumpe und damit wahrlich nicht arm an Drehmoment besonders im zugkraftintensiven unteren Drehzahlbereich. Mit der Pumpedüse gelang noch einmal eine deutliche Steigerung. Das gilt in beinahe
gleichem Maß für Motoren mit Common Rail. So erreicht ein Zweiliter-Triebwerk mit Aufladung bei Drehzahlen unter 2000 1/min ein
Drehmoment von weit über
300 Nm. Das sind Werte, die ein ähnlicher Benzinmotor zurzeit nicht erreichen kann.
Funktion
Schon bei geringen Drehzahlen muss Kraftstoff vom Tank zu den Pumpedüse-Elementen gefördert werden. Dies erledigt eine Sperrflügelpumpe, deren Arbeitsweise Sie ganz oben in bewegten Bildern sehen können.
Ein Verdränger mit (in diesem Fall) drei Nocken rotiert. Gegenüber seinem Zylinder werden oben und unten zwei Räume durch Sperrflügel abgetrennt, die durch Federn links und rechts gegen den Verdränger und
seine Nocken wirken. Die Sperrflügel müssen natürlich die gleiche Breite wie die Verdrängernocken und damit der ganze Pumpenraum haben. Je zwei Leitungen münden in die beiden hydraulisch voneinander
getrennten Räume. Am Anfang passiert ein Nocken jeweils die Saugleitung und vergrößert den Pumpenraum. Er würde die angesaugte Kraftstoffmenge immer weiter vor sich herschieben, wäre da nicht ein
Sperrnocken, der ihn zwingt, den Kraftstoff an die Druckleitung und damit an die Pumpedüsen abzugeben.
Eine Wissenschaft für sich ist das Verteilerrohr (Bild 3). Wenn Sie genauer hinschauen, sehen Sie unten ein dickeres Rohr für den Vorlauf, oben ein dünneres für den Rücklauf. Hier erfolgt durch eine Rohr-in-Rohr-
Konstruktion und entsprechende Öffnungen eine Mischung zwischen neu von der Kraftstoffpumpe gefördertem und von den jeweiligen Pumpedüse zurückkehrendem Kraftstoff. Dieser ist heißer. Wichtig ist bei dem
gesamten Prozess, dass jeder Zylinder Kraftstoff der gleichen Temperatur erhält. Bei Einspritzpumpen konnte dieser ca. 80°C erreichen, hier bis zu 120°C. Würden die Temperaturen differieren, so wäre das auch bei
den Einspritzmengen der Fall. Die hohe Temperatur ist auch der Grund für die Kühlung des Kraftstoffes im Rücklauf.
Natürlich ist nicht immer ein Verteilerrohr erforderlich. Meist werden die Pumpenelemente durch eine Bohrung im Zylinderkopf versorgt. Eine andere übernimmt dann den Rücklauf. Durch die Injektoren
aufzunehmender Dieselkraftstoff wird dann auch noch etwas gefiltert.